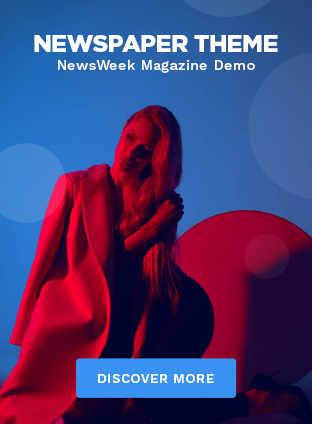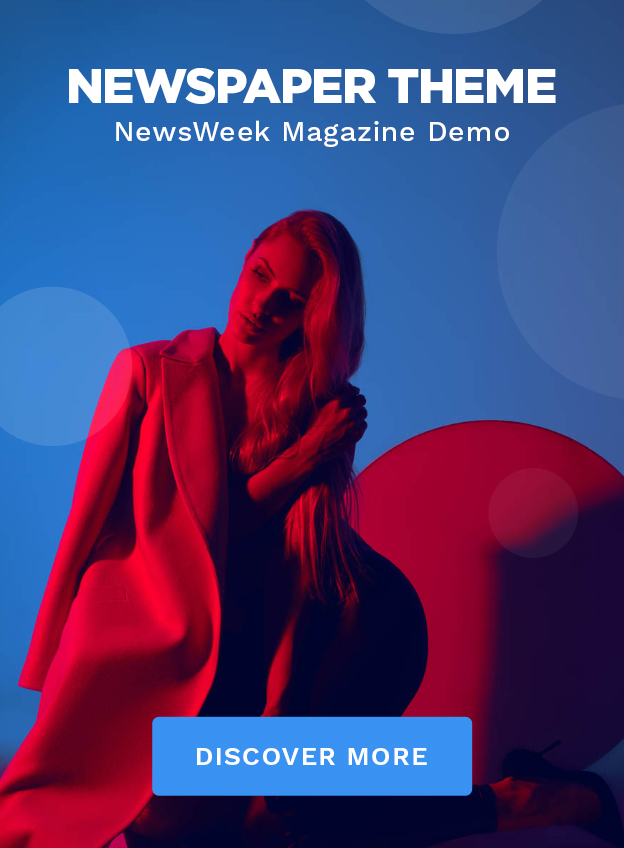Als es im Anschluss an den Vertrag von 1860 zwischen den Königreichen Spanien und Marokko das heutige Stadtgebiet Melillas zu bestimmen galt, feuerte man von der über der Mittelmeerküste thronenden Altstadt aus ein gutes Dutzend Kanonenkugeln damaligen Standards nach Nord, West und Süd ab. Wo sie einschlugen, zog man die Grenze. Nur an der Stelle, wo sich seit Jahrhunderten ein muslimischer Friedhof befand, macht die halbmondförmig verlaufende Linie einen Knick. Sichtbar wurde er erst, als Spanien, Marokko und die EU ab 1998 den ersten Grenzzaun errichteten. Nach und nach hat man ihn verdreifacht, auf bis zu sechs Meter erhöht, mit rassiermesserscharfen Klingen versehen und zu einer Hightech-Befestigungsanlage mit Nachtsichtkameras und Bewegungsmeldern im Boden aufgerüstet.
Von Stephanie Schuster
Melilla/Wien. Der Knick ist nun nicht mehr zu übersehen – und so wie der Grenzwall längst zum Sinnbild für die Flüchtlingskrise, für die Angst vor dem Fremden einerseits und die Hoffnung auf ein besseres Leben andererseits geworden ist, so könnte der Knick symbolisch für den Pragmatismus und die Flexibilität stehen, mit denen diese Stadt voller Gegensätze und Widersprüche ihren Alltag meistert. Für die zweierlei Maße, mit denen sie misst, für die Doppelmoral, die einem überall begegnet, oder für die Leichtigkeit, mit der unangenehme Fragen einfach ignoriert werden.

Geht man von der Plaza España in der Innenstadt die Avenida Juan Carlos I. hinauf, vorbei an endlosen, teils etwas heruntergekommenen, aber wunderschönen Jugendstilfassaden, könnte man sich einen Moment in Barcelona wähnen – und tatsächlich hat spanienweit nur die katalanische Hauptstadt mehr modernistische Bausubstanz aufzuweisen als Melilla. Es war Enrique Nieto, ein Schüler Gaudis, der sich einst aufmachte in den Norden Afrikas und die spanische Exklave architektonisch revolutionierte. Die katholische Kirche Sagrado Corazón und die Synagoge Or Zoruha tragen ebenso seine Handschrift wie die Zentralmoschee.
Alle drei Gotteshäuser können bei einem vom örtlichen Tourismusbüro organisierten Rundgang besucht werden, dazu ein hinduistischer Tempel – ein großes Wort für eine mit Sitzkissen und einigen bunten Buddhabildern dekorierte Hochparterrewohnung. Da der nächste Hindu-Priester in Málaga sitze, greife man beim Gebetsritual auf Fernseher und DVD zurück, erklärt Lachmi Ghanshandas, die Vorsteherin von Melillas hinduistischer Gemeinde, die bereits in fünfter Generation existiert, aber mit akuten Nachwuchssorgen kämpft. „Wir sind keine 100 Mitglieder mehr, die Jungen gehen eben weg.“ Auch Rabbiner Salomon Aserraf Cohen berichtet ein wenig wehmütig, dass es in der 85.000 Einwohner-Stadt heute nur noch knapp 1.000 Juden und sechs Synagogen gebe, während die hebräische Gemeinde vor rund 70 Jahren noch ein Drittel der Bevölkerung stellte.
Über die Befindlichkeiten der katholischen und muslimischen Gemeinde spricht niemand. Dabei ist offensichtlich, dass der Islam längst die vorherrschende Religion in Melilla ist, Spanier mit marokkanischen Wurzeln plus etwa 12.000 Marokkaner stellen mittlerweile gut 50 Prozent der Bevölkerung. Neun katholischen Kirchen, die selbst zur Sonntagsmesse nur mäßig gefüllt sind, stehen 16 Moscheen gegenüber, in denen es beim Gebet nach dem Fastenbrechen teils so eng wird, dass die Polizei das Gelände davor absperrt, damit die Gläubigen alle Platz finden. Die Festbeleuchtung in den Hauptstraßen der Innenstadt verheißt während des Fastenmonats einen „Feliz Ramadan“ und das islamische Opferfest ist seit einigen Jahren sogar gesetzlicher Feiertag. Innerhalb der EU ist das nur noch in Ceuta, der anderen spanischen Exklave, der Fall.
Wenngleich Kritiker es für reines Ablenkungsmanöver von der drohenden muslimischen Übermacht halten – die Stadtoberen erwähnen bei jeder Gelegenheit die vier Kulturen der Stadt, deren friedvolles Zusammenleben Melilla so einzigartig und zu einem Beispiel für die Zukunft ganz Europas mache. “Es gibt hier nicht mehr Konflikte als an anderen, weniger heterogenen Orten, und das ist allein der Verdienst der melillenses”, sagt Abdelmalik El Barkani stolz. Er hat es 2012 als erster Muslim ins Amt des Delegierten der Madrider Zentralregierung geschafft – als Kandidat der spanischen Volkspartei PP und nicht etwa im Namen der “Koalition für Melilla”, dem politischen Sprachrohr der marokkanischstämmigen Bevölkerung, die unter anderem fordert, den Berberdialekt Tamazight zur zweiten Amtssprache zu erheben. Wer Karriere machen will, muss sich dem Establishments beugen – und dessen Sprache sprechen. “Was uns eint, ist der Mantel der spanischen Flagge“, sagt El Barkani.
Die Dramen, die sich immer wieder abspielen, wenn schwarzafrikanische Migranten zu Dutzenden den Grenzzaun zu stürmen versuchen, oder die Polizeigewalt, die dabei laut Menschenrechtsorganisationen regelmäßig zum Einsatz kommt, haben im offiziellen Diskurs nichts verloren. Auch nicht der Rassismus, der sich in den abfälligen Bemerkungen der christlichen (und aus deren Sicht echten) Spanier über die moros, die muslimischen Mitbürger, und andersrum, widerspiegelt. Und erst recht nicht die „Cañada de Hidum“, besser bekannt als “Cañada de la Muerte” (Schlucht des Todes). Das Viertel aus würfelartigen, schmucklosen Häusern, die aus der Ferne wie bunte Legosteine wirken, ist fest in muslimischer Hand und absolute No go-Area für aromis, wie die christlichen Spanier im Berberidiom heißen. In den verwinkelten Gassen trifft man auf kleine Teestuben, spielende Kinder und mit Fan-Botschaften des IS beschmierte Wände. Selbst die Polizei schaut hier nur noch gelegentlich für Drogenrazzien vorbei oder um mutmaßliche Dschihadisten zu verhaften. Die Weiße Moschee des Viertels gilt als Keimzelle islamistischen Terrors.

Tania Costa, Chefredakteurin der Lokalzeitung „El Faro“, spricht indes Tacheles. „Diese Stadt ist echt hart“, sagt die gebürtige Kubanerin, die seit fünf Jahren in Melilla lebt. Da sei die Enge, die manchen Bewohner dazu veranlasst, ohne Not ins Auto zu steigen und eine Runde um die Stadt zu drehen, selbst auf die Gefahr hin, in einen Stau zu geraten. „Ich dachte, die sind verrückt hier“, erzählt Costa. „Aber dann hab ich dazu einen Psychologen interviewt, der mir sagte, dass die Leute das tun, weil es entspannt und befreiend wirkt.“ Da seien die extremen sozialen Gegensätze: auf der einen Seite die Besserverdiener, die größtenteils dem aufgeblasenen Beamtenapparat angehören, der nach wie vor von den Christen dominiert wird und üppige Ortszulagen kassiert – auf der anderen Seite das Gros der Muslime. „Die haben viele Kinder, aber keine Ausbildung und keine Jobs“, sagt Costa, die mit ihrem dunklen Teint oft selbst für eine Muslimin gehalten wird. „Dass es hier Diskriminierung gibt, kann ich bestätigen: Ich werde im Krankenhaus schlecht behandelt, bis sie meinen Namen lesen oder ich den Mund aufmache.“ Als günstige Kindermädchen hingegen seien die Marokkanerinnen sehr gefragt, ebenso als Haushälterinnen, die neben Paella und Tortilla gern auch mal Tajine mit Dattelfleisch oder Couscous auftischen dürfen. Und den morgendlichen café con leche trinkt man natürlich – es gibt ja kaum mehr Alternativen – in der Bar eines marokkanischstämmigen Mitbürgers, wo freilich auch der feine Minztee auf der Karte steht.
Filmemacher Driss Deiback, der in Paris studiert und viele Jahre in den USA und in Berlin gelebt hat, widmete seiner Heimatstadt 2002 eine überaus kritische Doku, die die Stadtspitze anfangs sogar zensieren wollte. Heute stimmt er versöhnlichere Töne an. “Wir sind irgendwo zwischen Nebeneinanderher- und Zusammenleben.” Es gebe inzwischen über 3.000 gemischte Ehen, die hier stationierten Soldaten seien zu einem Drittel muslimisch, selbst muslimische Ärzte und Anwälte seien keine Seltenheit mehr, sagt Deiback. Richtig in Rage bringt ihn jedoch ein anderes Thema, bei dem in Melilla immer noch eigene Maßstäbe gelten: In der Stadt stehen mehrere Franco-Denkmäler herum – eines davon gerade frisch restauriert –, obwohl Spanien deren Verbannung bereits 2007 per Gesetz angeordnet hat. „Und wer denkt, die Franco-Statue im Hafen wurde versetzt, damit sie nicht mehr gar so exponiert wirkt, der irrt“, verkündet Deiback mit einem triumphierenden Lacher. Der alte Diktator sollte vielmehr vor Vandalen geschützt werden. „Er steht jetzt direkt vor der Überwachungskamera an der Hafeneinfahrt.“
Unweit der Innenstadt, im Rastro-Viertel, stapeln sich Obst- und Gemüsekisten auf dem Asphalt, auch Klamotten und Haushaltswaren breiten die Händler einfach auf dem Boden aus, während sich verschleierte Frauen mit Einkaufstrolleys und voll bepackten Tüten durchs Getümmel schieben. Kulturministerin Fadela Mohatar, ebenfalls von der PP, ebenfalls Muslimin, ist in dem Viertel aufgewachsen, heute fühlt sie sich fremd. „Die Berberfrauen haben höchstens mal ein Kopftuch getragen.“ Doch nun seien hier die strenggläubigen Strömungen des Islam auf dem Vormarsch, sagt Mohatar. Sogar junge Frauen gingen nur noch verhüllt auf die Straße. Als sie am Morgen ganz in der Nähe in kurzem Kleid im Wartezimmer eines Arztes saß, wurde sie mit missbilligenden Blicken gestraft. „Das wäre vor 20 Jahren nicht passiert, und das macht mir Sorge.“
Die Marktleute treibt anderer Kummer um. „An der Grenze ist es grade kompliziert“, sagt Hamid, der jeden Tag mit Säcken voller Gebäck aus der Nachbarprovinz Nador nach Melilla kommt. Etwa 30.000 Marokkaner haben eine Arbeitserlaubnis für die spanische Stadt: Sie liefern Fisch, verkaufen Schmuck, fahren Taxi oder putzen bei den aromi. Am wichtigsten aber sind die Transporteure, die jeden Tag tonnenweise Waren – auf dem Rücken, im klapprigen Mercedes oder Lastwagen – von Melilla nach Marokko bringen. Dass die spanischen Behörden dem irren Treiben, das sich tagtäglich am Grenzposten abspielt und freilich auch Schmugglern Tür und Tor öffnet, mit limitierten Passierzeiten Einhalt gebieten wollen, führt seit Wochen zu Protesten. Großhändler und Geschäftsleute klagen über Umsatzeinbußen. „Diese Stadt lebt von der Grenze“, sagt Metzger Mohamad. Von seinem Tresen sind es keine 20 Meter bis zum Grenzübergang – wo Europa endet und Afrika beginnt. Weil dort vor 157 eine Kanonenkugel einschlug.